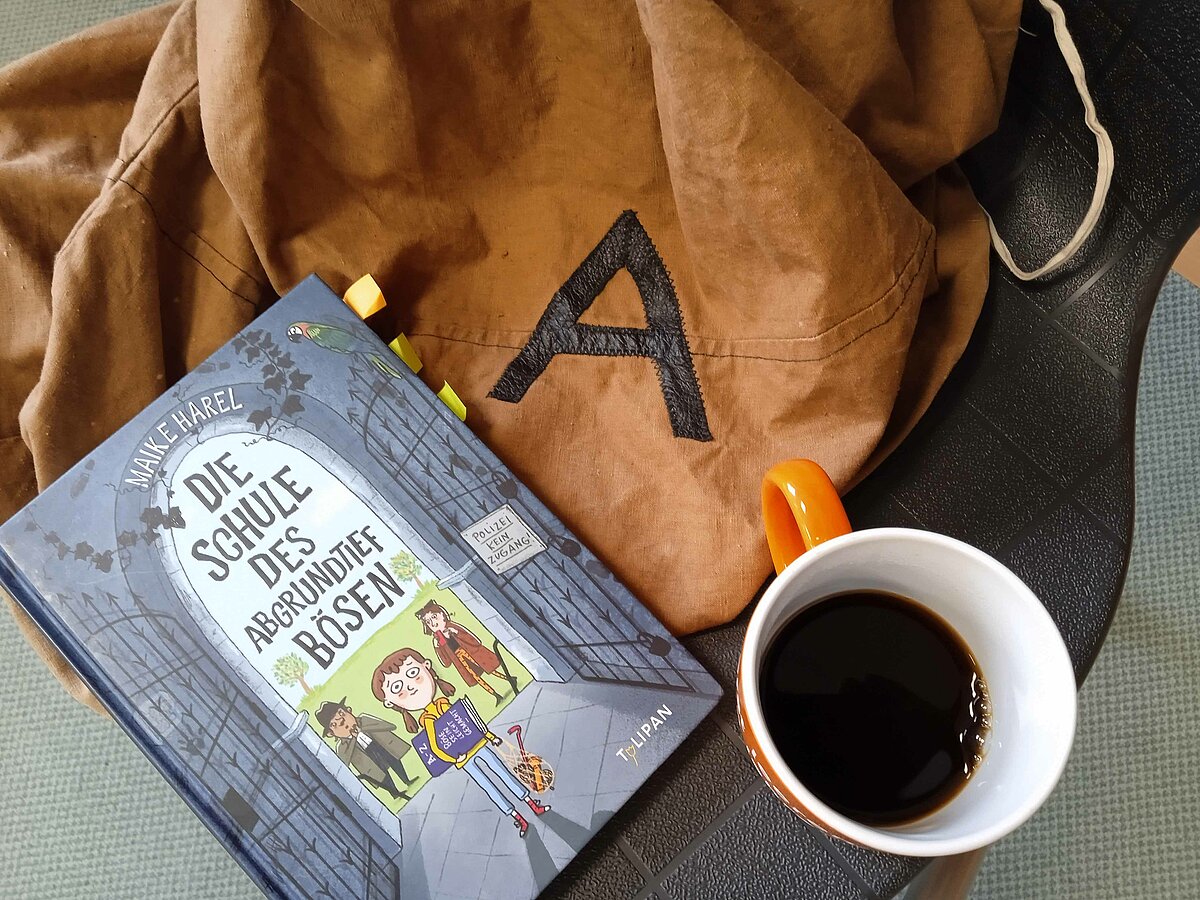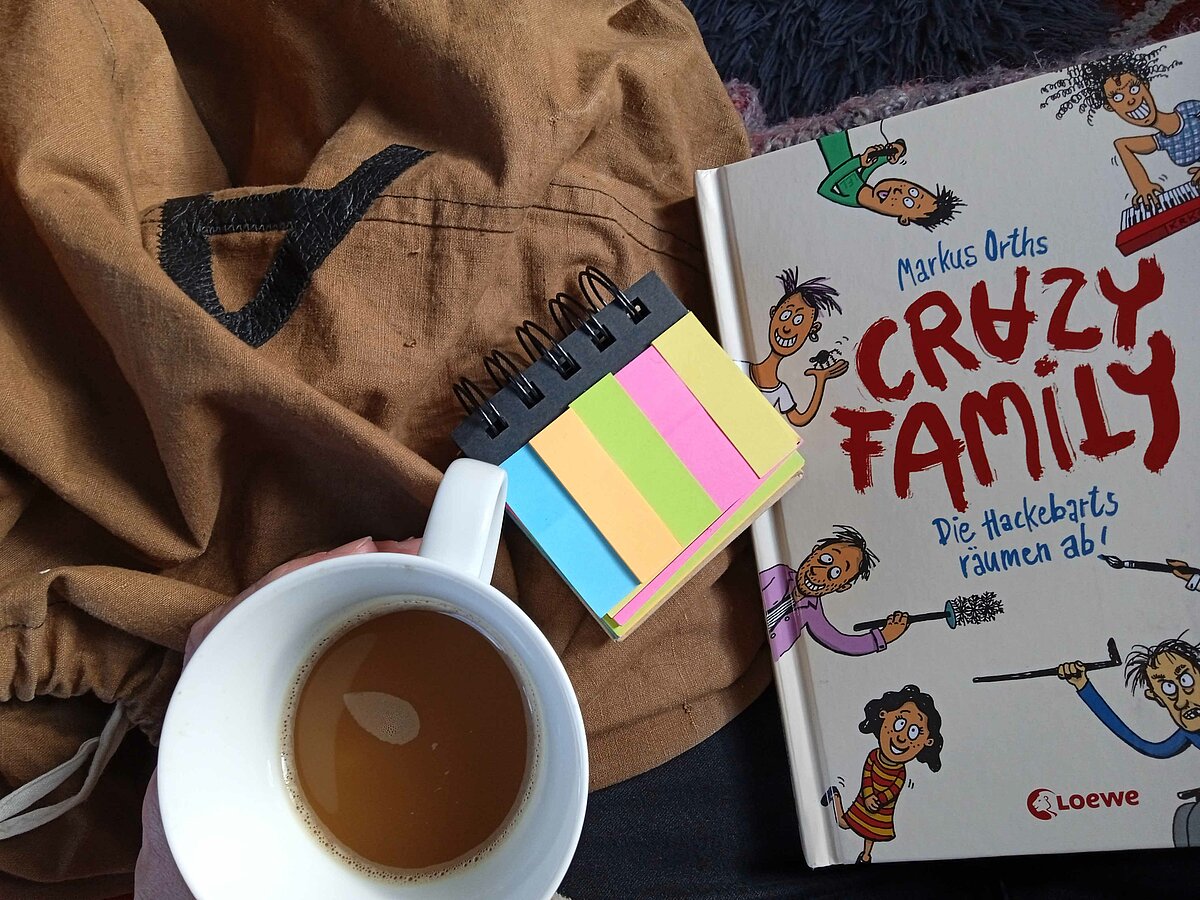Lesen zum Vergnügen – das klappt trotz anhaltend düsteren Pisa-Prognosen. Solange Eltern ihren Kindern vorleben, wie Erzählen Beziehung stiftet, gibt es keinen Grund zu jammern. Ein Best-Practice aus Berlin.
Selma geht in die vierte Klasse und ist in diesem Schuljahr Buchreporterin an einer Grundschule in Berlin-Kreuzberg. In den vergangenen Wochen hat sie »Valerie. Die Meisterdiebin von Paris« gelesen. »Es hat 256 Seiten«, betont die Grundschülerin, zu Recht ist sie stolz auf ihre Leistung. Lukas mischt sich ein: »Mein Buch hatte auch 256 Seiten.« Selma grinst, dann geben sich beide einen Faustcheck unter Teamkollegen. An diesem Vormittag stellt die Buchreportergruppe, neben Selma und Lukas sind das drei weitere Tandems der vierten Klasse, ihre Titel vor. Sie besucht dazu die Klassen 4 und 5 der Schule. Je zwei Kinder je eine Klasse in der dritten, der vierten und der fünften Stunde. Die Einsätze haben wir gelost. Lukas und Selma fangen an. Es ist die Woche vor den Herbstferien und der Termin bewusst gewählt, um unter Gleichaltrigen fürs Lesen in der schulfreien Zeit zu werben. Das klappt besser, wenn es von Kindern kommt.
Im Schulhaus gongt es zur dritten Stunde. Schnell schieben die Kinder ihre Bücher in den Bauch von Albert. So heißt mein Lesesack, der bei jedem Einsatz dabei ist und dafür sorgt, dass es zunächst spannend bleibt, weil die Bücher nicht sofort sichtbar sind, sondern publikumswirksam aus dem Sack gelassen werden. Ich begleite die Bucherreporter, aber nur zur An- und Abmoderation. Damit die Buchvorstellung einen Rahmen hat, den Kindern aber auch klar ist, dass ihre Leistung im Zentrum steht. Deshalb bekommen sie den Albert von mir ausgehändigt; ein Moment, der für die Mädchen und Jungen etwa so weit oben rangiert wie die Übergabe der Meisterschale am Ende der Bundesligasaison. Ein Anlass, den die Schule mitwürdigt: Das Knacken über unseren Köpfen kündigt die Durchsage der Schulleitung an: »Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, in den Klassen 4 und 5 sind heute unsere Buchreporter unterwegs. Viel Spaß und viel Erfolg!« Selma presst Albert an sich, Lukas wischt sich den Pony aus der Stirn und lächelt zaghaft zu mir hoch. Ich erkläre: »Sobald wir über der Schwelle sind, ist eure Nervosität überwunden.« Es klingt wie eine Zauberformel.
Indem ich die Szene nacherzähle, möchte ich zwei Dinge vermitteln, die in der Leseförderung absolut gesetzt sind, Wertschätzung und Rituale. Erstens: Lesen ist ein sinnliches Ereignis, das seinen Zauber in der Wiederholung entfaltet. Wer liest, produziert Kopfkino. Zweitens: Lesen ist eine Leistung. Nicht nur aber auch quantitativ. Dass Viertklässler zu Titeln mit 256 Seiten Umfang greifen, ist selten geworden. Wenn Kinder im Deutschunterricht Bücher vorstellen, liegen die gewählten Titel bei um die 80 Seiten, verraten Erfahrungswerte von (Schul-)Bibliotheken, deren Personal die Jungen und Mädchen berät und motiviert. Manchmal springen ihnen die Lehrer/-innen bei, wenn dem Kind partout keine Vorliebe für ein Genre einfällt. Und die Eltern? Guter Punkt. Entscheidender Punkt.
Kinder lesen weniger. An der Konkurrenz der Bewegtbildmedien liegt das nicht allein. Mehr ins Gewicht fällt der Rückgang lesender Vorbilder. Kinder lernen, indem sie nachahmen. Das gilt auch für den Griff zum Buch. Als ich meine Buchreporterin Selma kennenlernte, sagte die: »Mama und Papa sitzen abends bei uns auf dem Sofa und jeder schaut auf sein Smartphone. Wieso sollte ich dann ein Buch lesen?« Die Frage ist berechtigt, deshalb habe ich Selma vorgeschlagen, sie ihren Eltern einmal selbst zu stellen. Meine Antwort lautete: »Weil kein Bildschirm mit einem Buch mithalten kann.« Lesen macht uns in unserem eigenen Tempo mitfühlend und beziehungsfähig. Wenn wir gelernt haben, dass es sich gut anfühlt, Komplize oder Komplizin der handelnden Figuren zu sein, mit ihnen Konflikte durchzustehen und zu lösen, gelingt das auch bei uns selbst.
Verkümmert die Beziehungsarbeit in den Familien, strahlt das auf die Lesekompetenz aus. Spreche ich das so auf Elternabenden an, ist das Stimmungsbild folgendes: Ein Drittel beschämtes Nicken, zum Beispiel bei Selmas Eltern, ein Drittel fragende Blicke, ein Drittel lautstarker Protest. Kinder in Klasse 4 könnten selbständig lesen, ist dann eins der Argumente, die meine These entkräften sollen. Ein anderes: Das Kind habe ein Regal voller Bücher im Zimmer stehen, es brauche nur zuzugreifen, sogar die eigenen Lieblingstitel von früher hätten die Eltern aufgehoben. Dazu zwei Anmerkungen, erstens: Ein Bücherregal ist keine Leseförderung; zweitens: Geschichten sind – ausgenommen einige Klassiker wie Michael Ende oder Astrid Lindgren, die immer gehen – Amöben; sie umfließen die Lebenswelt der Kinder und passen sich ihr an. Ich habe als Elfjährige »Gretchen Sackmeier« von Christine Nöstlinger geliebt. Mein gleichaltriges Patenkind kann 30 Jahre später nichts damit anfangen. Die Sprache ist eine andere – zum Beispiel sind Schillinge keine Währung mehr – und dass Kinder mit getrennten Eltern groß werden, ist Normalität. Es als Ausnahme von der Regel zu erzählen, wirkt seltsam aus der Zeit gefallen. Apropos: Die Mutter meines Patenkindes wiederum erzählte frustriert, die Tochter habe den von ihr einst geliebten Benno Pludra nach zwei Kapiteln zur Seite gelegt. So wunderbar DDR-Kinderbücher erzählt sind, so deutlich zeigen sie dem Kind und damit auch uns Großen auf: Es war einmal. Fazit für Eltern: Euer Kind liest nicht, was ihr lest. Aber es liest, weil ihr lest. Wenn ihr lest – und das Smartphone abends dafür aus der Hand legt.
Meine Antwort auf die Frage, wie ein Kind Leser oder Leserin wird, ist, zusammengefasst: Indem es andere Lesende um sich hat und die Erfahrung machen darf, in deren Faszination fürs Erzählen hineingenommen zu sein. Die Familie legt den Grundstein. Schule und Bibliothek können aufsatteln, aber nicht das Gefühl von Freiheit und wie man es auf dem Rücken des Pferdes spürt, lehren; zumal der Bildungsauftrag der Schule viel breiter aufgestellt ist. Eltern zu zwingen, ihren Job zu machen, gehört nicht dazu.
In der fünften Unterrichtsstunde an der Berliner Grundschule sind Elli und Yunus dran. Elli kommt von der Toilette gerannt, »war meine Frisur prüfen«, sagt sie atemlos. Elli hat sich für den Auftritt von ihrer älteren Schwester Braids flechten lassen, viele kleine Zöpfchen. Sie bittet mich, ein Foto von ihr mit Lesesack Albert zu machen, damit sie es später ihrer Schwester zeigen kann. Yunus darf auch aufs Bild. Er hebt die Hand und macht das Victory-Zeichen. Dieses Tandem ist besonders, Elli und Yunus haben ihr Buch gemeinsam gewählt und gelesen. Elli ist, in der Sprache des Fachbereiches Deutsch formuliert, ein Drei-Pfeile-Kind; heißt, sie hat eine hohe Lese- und Sprachkompetenz. Yunus hat sich von einem auf zwei Pfeile gesteigert. Das hat das Buchreporterprojekt bewirkt, in welches der Junge mit dem Satz eingestiegen war: »Ich lese doch nicht zu meinem Vergnügen.« Dann stellte er fest: Lesen IST Vergnügen. Und zwar ein konspiratives, denn das Buch, mit dem er vor die anderen Kinder tritt, kennen nur er und Elli. Einer meiner besten Momente in der Literaturvermittlungsarbeit mit den beiden war, als Elli erklärte: »Bei der Buchvorstellung musst du vorlesen, Yunus, du betonst voll gut und klingst echt spannend.« Ich bin überzeugt, vor seinen Kumpels hätte er das Kompliment abgetan, um cool zu wirken. Im geschützten Raum konnte er Ellis Wertschätzung sacken lassen. Ich wünsche ihm sehr, dass ihn diese Erfahrung trägt. Denn während Elli, inspiriert von der älteren Schwester, viel liest, hat Yunus zu Hause keine lesenden Vorbilder. Vielleicht kann er selbst eins werden.
40 Minuten später klatscht die Klasse dem Buchreporter-Tandem Beifall und in der Feedbackrunde sagt prompt ein Kind: »Yunus klang wie ein Hörspielsprecher!« Sein Gesicht leuchtet. »Ich habe auch fett geübt«, offenbart der Zehnjährige. Yunus schaut zu Elli, die Albert knautscht und ihren Mitschüler erwartungsvoll ansieht. Dann sagt er: »Hat sich gut angefühlt.«
Nach der letzten Stunde nehme ich alle sechs Buchreporter vor ihrer Klasse nach vorne. Alle erhalten unter Beifall eine Urkunde. Dann startet die Lehrerin einen Filmclip auf dem Whiteboard. Das Gesicht einer Frau erscheint: »Hallo liebe 4c«, begrüßt sie die Kinder. »Das sind wir«, schreit ein Junge begeistert. Die Frau im Video stellt sich vor, es ist Andrea Schütze, Autorin von »Valerie. Die Meisterdiebin von Paris«. Ich hatte sie angeschrieben und gebeten, für die Kinder ein Dankeschön einzusprechen – stellvertretend für die Autor/-innen der vorgestellten Bücher. Jedes Mal macht ein Autor oder eine Autorin diesen Spaß mit, zuletzt war es Martin Muser. Es ist noch einmal eine Form der Wertschätzung für die Kinder. Autor/-innen sind schließlich berühmt. Andrea Schütze verrät, dass sie der Klasse zum Dank gerne ein Autogramm schicken würde, »dafür brauche ich die Vornamen von allen, die eins möchten. Da frage ich eure Lehrerin. Wer keines haben will, darf sich trauen das zu sagen, kein Problem.« Dann ist das Video vorbei. Obwohl nur Selma »Valerie« gelesen und vorgestellt hat, gehen, als sich die Lehrerin zur Klasse umdreht, alle Finger nach oben.