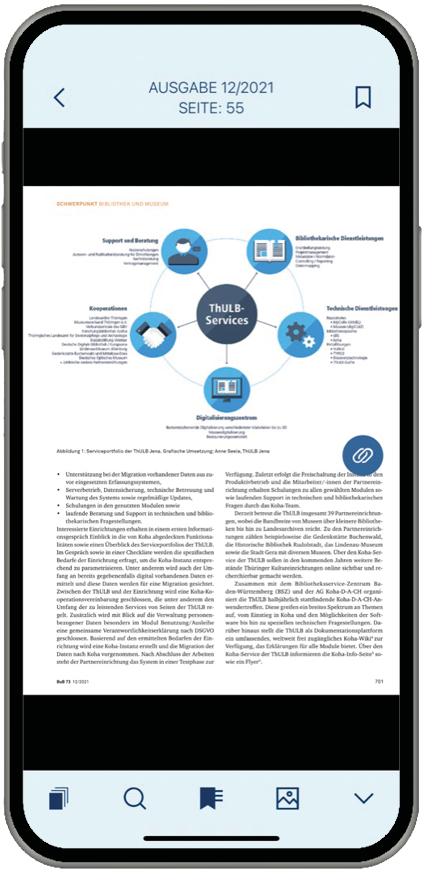»Das Deutsche Bibliotheksinsititut im Spannungsfeld zwischen Auftrag und politischen Interessen«. Klingt wie jede andere Dissertation? Nicht ganz. Zum einen handelt es sich um die erste umfassende Auseinandersetzung mit dem 2000 geschlossenen Deutschen Bibliotheksinstitut, zum anderen ist die Doktorandin bereits 80 Jahre alt. Die Autorin Helga Schwarz aus Berlin zählt zu den Spätberufenen. Mit BuB-Redakteur Steffen Heizereder spricht sie im Interview über ihre Motivation zu promovieren, die Reaktionen aus ihrem privaten Umfeld und das große Aufräumen danach.
BuB: Frau Schwarz, Glückwunsch zur Promotion über das Deutsche Bibliotheksinstitut (DBI), die Sie mit Magna cum Laude bestanden haben. Wie geht es Ihnen jetzt?
Helga Schwarz: Ich kann es immer noch nicht fassen, dass es nun vorbei ist und dass ich alles überstanden habe.
Über Alter spricht man ja eigentlich nicht, aber in Ihrem Fall muss ich natürlich nachfragen. Sie sind 80 Jahre alt. Wieso haben sie sich mit Mitte 70 noch dazu entschieden zu promovieren?
Das war schon immer mein Wunsch. Ich wollte das eigentlich gleich im Anschluss an meinen Magistergrad 1995 machen. Der Professor damals hat mich auch sehr ermuntert. Aber dann war ich nach der Magisterarbeit erstmal sehr krank. Ich war vollkommen erschöpft, denn ich hatte ja das Magisterstudium neben voller Berufstätigkeit und noch mit Kind zuhause durchgezogen. Dann gab es familiäre Gründe, warum ich mich dem nicht gleich widmen konnte und schließlich starb der Professor. Es blieb einfach liegen. Aber der Wunsch, noch einmal den Doktor zu machen, der blieb. Der zweite Beweggrund war, das DBI selbst, das ein Teil meines Lebens ist. Als es im Jahr 2000 plötzlich weg war, konnte ich das gar nicht fassen. Ein gutes Thema für eine Doktorarbeit und das persönliche Interesse am Schicksal des DBI haben mich bewogen, das Projekt anzugehen. Es gab ganz unterschiedliche Meinungen in der bibliothekarischen Öffentlichkeit, warum das DBI untergangen war: Es gab Gerüchte, Schuldzuweisungen, die alle irgendwie nicht stimmig waren. Das wollte ich gründlich aufarbeiten und zugleich eine vollständige Darstellung des DBI hinlegen, von der Gründung bis zur Auflösung.
Was verbindet Sie mit dem Deutschen Bibliotheksinstitut?
Ich habe 1972 angefangen, dort zu arbeiten. Da gab es das DBI noch nicht, aber die Vorgängereinrichtung »Arbeitsstelle für Bibliothekstechnik«. Bis 1989 war ich im DBI beschäftigt. Und ich bin eine der Mütter der Zeitschriftendatenbank.
»Niemand hatte sich mit dem Thema davor beschäftigt, insbesondere nicht mit dem Hinscheiden des DBI.«
Sie haben es schon angesprochen, Sie wollten eigentlich Ihre Promotion an den Magisterabschluss anhängen. Diesen haben Sie 1995 und ihr Diplom sogar schon vor 60 Jahren an der Berliner Bibliothekarschule abgelegt. War es nicht schwer, sich nach so langer Zeit wieder an das wissenschaftliche Arbeiten heranzuwagen?
Nicht so sehr. Ich habe ja auch in meiner Eigenschaft als Kommissionsvorsitzende für neue Technologien im damaligen Verein der Diplom-Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken (VdDB) publiziert. Ich habe auch häufig in BuB veröffentlicht und auch in »Bibliothek, Forschung und Praxis« hatte ich mal einen großen Artikel. So ungewöhnlich war das nicht. Ich konnte schreiben, ich schreibe gerne. Das wissenschaftliche Schreiben einer Dissertation war dann allerdings doch nochmal etwas anderes. Da hat mir dann meine Doktormutter, Claudia Lux, gehörig auf die Sprünge geholfen.
Hatten Sie Angst, dass Sie die Promotion nicht schaffen würden?
Ja, und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Ich war schon älter. 2015 hatte ich erhebliche gesundheitliche Probleme und da kam dann auch manchmal die Angst auf, dass das ganze irgendwann liegenbleiben würde. Und als es dann 2016 am Anfang doch wieder etwas voranging und ich schon große Teile der Arbeit fertig hatte, hat meine Doktormutter zu mir gesagt, dass ich ein Einlegeblatt in mein Testament legen soll, damit das Werk so wie es damals war, auf jeden Fall veröffentlicht werden sollte, auch wenn ich die Arbeit nicht mehr zu Ende hätte führen können. Dieses Blatt liegt noch immer in meinem Testament. Jetzt ist das Buch ja erschienen. Da kann ich es wieder rausnehmen.
»Ich habe niemandem etwas gesagt. Meine Familie wusste es bis zur Veröffentlichung des Buches nicht.«
Wie hat Ihre Doktormutter, Claudia Lux, ursprünglich reagiert, als Sie mit dem Wunsch zu ihr gekommen sind zu promovieren?
Gut, geradezu freudig. Claudia Lux fand gleich, dass das ein tolles Thema ist. An der Fakultät an der Humboldt-Universität haben mich ohnehin alle dazu ermutigt. Sie haben gewusst, wenn ich die Arbeit nicht mache, macht es auch niemand anderes. Ich hatte durch meine Verbandstätigkeit natürlich auch alle Kontakte zu Persönlichkeiten aus der Bibliotheksszene. Ich konnte jeden anrufen und jeder hat mir Auskunft gegeben.
Das hört sich nach echter Grundlagenarbeit an. Gab es viel Literatur, auf die Sie sich stützen konnten?
Gar keine! Niemand hatte sich mit dem Thema davor beschäftigt, insbesondere nicht mit dem Hinscheiden des DBI. Was es gab, waren die jährlichen- oder zweijährlichen Arbeitsberichte des DBI selbst und ein paar Zeitschriftenaufsätze, im Bibliotheksdienst etwa. Das war es aber schon an veröffentlichter Literatur. Meine hauptsächlichen Quellen waren Dokumente in Archiven und Zeitzeugen.
Wie lange haben Sie für die Arbeit gebraucht?
Sechs Jahre.
Sechs Jahre sind eine lange Zeit, die Sie für die Promotion verwendet haben. Wie hat denn ihr persönliches Umfeld darauf reagiert?
Ich habe niemandem etwas gesagt. Meine Familie wusste es bis zur Veröffentlichung des Buches nicht. Erst dann haben Sie erfahren, dass ich gearbeitet und promoviert habe. Ich habe auch meinen Freunden, meinen Klassenkameraden, in den vielen Clubs und Vereinen, in denen ich mich engagiere, nichts erzählt.
War es schwierig, ein so großes Projekt so lange geheim zu halten?
Nein, ich lebe ja alleine. Meine Familie wohnt in Hamburg. Insofern war das einfach. Ich musste einfach nur meinen Mund halten.
Kommen wir nochmal auf Ihre Doktormutter zurück: Wurden Sie genauso behandelt, wie alle anderen Doktoranden?
Ja, das wurde ich durchaus. Wir haben in der Humboldt-Universität im Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft zweimal jährlich ein Doktorandenkolleg. Da hab ich mich mit den anderen Doktoranden getroffen und auch mit dem Vorsitzenden der Prüfungskommission. Das war bis vor kurzer Zeit Professor Konrad Umlauf. Ich bin genauso behandelt worden wie alle anderen – und auch genauso kritisiert. Frau Lux, hatte ich das Gefühl, behandelte mich genauso wie ihre anderen Doktoranden. Ich bin ja nicht die einzige Doktorandin, die sie betreut.
Wie sah denn der Kontakt zu den anderen Doktoranden aus? Gab es Berührungsängste oder waren Sie voll integriert?
Ich war vollkommen integriert. Das war übrigens schon bei meinem Magisterstudium der Fall. Da war ich ja auch schon über 50. Damals bin ich zur Studienberatung gegangen und hab das angesprochen, wie es denn wohl so wäre, als Ältere zwischen lauter jungen Studenten zu studieren. Da hat man mich sehr ermutigt und gesagt, dass alles ganz wunderbar sei und, dass ich sicher von allen ins Herz geschlossen werden würde. Und so war es. Auch bei der Promotion habe ich mit den anderen Doktoranden, die ja zumeist berufstätig sind und gar nicht in Berlin wohnen, zeitweilig E-Mail-Kontakte gehabt. Aber eigentlich haben wir uns immer nur alle halbe Jahre zum Doktorandenkolleg getroffen.
»Die ganzen Aktenordner in meinem Arbeitszimmer sind immer mehr geworden. Da muss ich jetzt so langsam etwas aussondern.«
Am 16. Februar hatten Sie Ihre Verteidigung. Was ist denn seither passiert?
Nur feiern. Das Buch ist mittlerweile von der Druckerei geliefert worden. Es ist hübsch anzusehen und ich habe fünf Belegexemplare erhalten, die ich teilweise an Freunde versandt habe. Außerdem bin ich damit beschäftigt, ein bisschen aufzuräumen zuhause. Die Aktenordner mit den vielen Dokumenten, die ich in den Archiven gefunden habe, sind in meinem Arbeitszimmer immer mehr geworden. Da muss ich jetzt so langsam etwas aussondern.
Werden Sie an dem Thema dranbleiben?
Das ist abgeschlossen. Ich glaube, ich habe über das DBI umfassend berichtet, von der Vorgängerinstitutionen angefangen, über die Gründung, seine Tätigkeit und die Evaluationen, die es durch den Wissenschaftsrat erfahren hat, bis hin zu seiner Auflösung. Und ich habe ja auch noch das EDBI behandelt und die Bemühungen um ein Nachfolge-Institut. Ein Informationszentrum für Bibliotheken war lange in der Diskussion. Aber daraus ist ja auch nichts geworden. Auch das ist ein Kapitel in meinem Buch. Ich denke, das Thema ist damit abgeschlossen.
Setzen Sie sich jetzt zur Ruhe oder folgt auf den Doktortitel noch eine Habilitation?
Nein, in dem Fach jetzt eigentlich nicht mehr. Ich bin noch an einem anderen Buchprojekt zu einem ganz anderen Thema dran. Und ansonsten bin ich in sehr vielen Vereinen und Initiativen aktiv. Ich bin Mitglied im Pazifik-Netzwerk und kümmere mich um Samoa, ich bin Mitglied in der Alzheimer-Gesellschaft und natürlich im BIB, ich mache Tai-Chi, ich bin Lesepatin in einer Willkommensklasse in einer Berliner Grundschule und gehe regelmäßig ins Fitness-Studio. Ich bin in sehr aktiv, mein Tag ist wirklich voll ausgefüllt.
Also langweilig wird Ihnen nicht?
Nein, ich hab immer einen Terminkalender, der aussieht wie bei einem Manager.